Aus der Krise lässt sich was machen
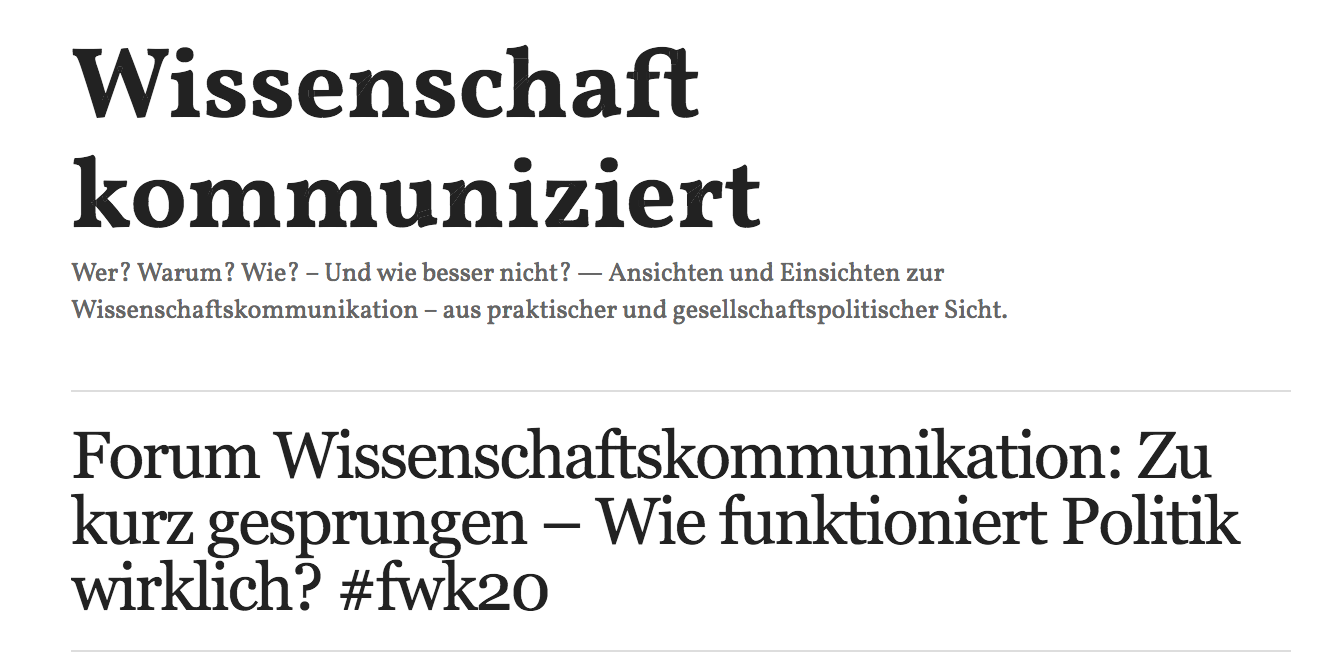
Aktuelles Thema auf Reiner Korbmanns Blog
E-Mail-Interview mit dem Wissenschaftskommunikator Reiner Korbmann
Der in München lebende Journalist Reiner Korbmann ist seit über 50 Jahren im Wissenschaftsjournalismus tätig, seit einigen Jahren begleitet er das Genre mit dem Blog „Wissenschaft kommuniziert“ – „Wer? Warum? Wie? – Und wie besser nicht? – Ansichten und Einsichten zur Wissenschaftskommunikation – aus praktischer und gesellschaftspolitischer Sicht“. Der Beitrag erschien innerhalb des Titelthemas Wissenschaft des BJVreport 5/2020, als Ergänzung zum Print-Beitrag „Der Mediendoktor auf Visite. Kolleg*innen untersuchen wissenschaftsjournalistische Texte“. Beide Texte widmen sich auf konstruktive Art und Weise der Medienkritik und dienen der Weiterentwicklung des Wissenschaftsjournalismus.
Das Interview mit Reiner Korbmann wurde aus Zeitgründen per E-Mail geführt. Von Thomas Mrazek.
Wie schätzen Sie den heutigen Wissenschaftsjournalismus ein, der sich zurzeit ja besonders in der Corona-Krise beweisen muss? Machen die Kolleg*innen nach Ihren Beobachtungen einen guten Job, funktioniert die Wissenschafts-PR und/oder die unmittelbare Kommunikation mit der Wissenschaft gut?
Ich unterscheide grundsätzlich zwischen Wissenschaftsjournalismus, der als Journalismus Teil der Medien ist, und Wissenschaftskommunikation, die zum System der Wissenschaft gehört, die sozusagen das Außenbild der Wissenschaft mitgestaltet – so wie man zwischen Wirtschaftsjournalismus und Unternehmenskommunikation unterscheidet. Natürlich kann man im rein semantischen Sinne beides unter Kommunikation subsumieren, dann hat man aber Probleme mit der Abgrenzung – was ist dann keine Wissenschaftskommunikation?
Ich denke, der Wissenschaftsjournalismus hat heute ein sehr viel höheres Niveau als zu der Zeit, als ich anfing: damals betrachteten sich die Wissenschaftsjournalisten überwiegend als „Dolmetscher“ der Wissenschaftler, also als reine Übersetzer in verständliche Sprache. Heute ist das journalistische Element deutlich weiter entwickelt – Recherche, unterschiedliche Darstellungsformen, es gibt sehr gute Ausbildungsmöglichkeiten und die Diskussion über journalistische Qualität ist intensiv.
Das kam jetzt in der Corona-Krise sehr positiv zum Tragen. Allerdings hat ein großer Teil der Wissenschaftsjournalisten nicht geschafft, was ein Virologe (Prof. Christian Drosten) beispielhaft vorgeführt hat, nämlich: die Brücke zu bauen von der Logik der Wissenschaft in die Logik gesellschaftlichen Handelns. Das aber wäre meines Erachtens eine wichtige Rolle von Wissenschaftsjournalismus. Wieweit dies damit zusammenhängt, dass die meisten Wissenschaftsjournalisten in der Wissenschaft sozialisiert wurden und erst später in den Journalismus wechselten, sollte man diskutieren.
Die Wissenschafts-PR, um damit die eigentliche Wissenschaftskommunikation anzusprechen, hat im Krisenmodus gut funktioniert, aber zum größten Teil die historische Chance noch nicht erkannt, die sich ihr jetzt bietet: Noch nie – und ich überblicke persönlich immerhin die letzten fünf Jahrzehnte, inklusive Mondlandungs-Hype – noch nie wurde Wissenschaft von der Gesellschaft als so wertvoll empfunden, wurde so wichtig genommen, wie in dieser Krise. Da lässt sich etwas daraus machen. Und die Wissenschaft? Die hat in dieser Zeit vor allem persönlich kommuniziert, zum Teil beispielhaft, zum Teil in alter Manier („Der Professor weiß es“), zum Teil ließen Wissenschaftler sich von der Politik missbrauchen.
Welche Relevanz haben nach Ihren Beobachtung wissenschaftsfeindliche Akteure, die in Filterblasen ihre eigenen Wahrheiten verbreiten – kann sich der Wissenschaftsjournalismus gegen solche „Fake News“ behaupten?
Diese Akteure sind ein gesellschaftlich interessantes und beachtenswertes Phänomen, um das sich die Sozialwissenschaften intensiv kümmern muss. Damit sind sie natürlich auch Medienthema, auch für Wissenschaftsjournalisten (die sich, wenn sie das Überbrücken der Systemlogiken ernst nehmen, ihrerseits stärker um die Sozialwissenschaften kümmern sollten). Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass dieses Phänomen von einzelnen Medien auch überbetont wird. Da halte ich andere Randgruppen für mindestens ebenso interessant, etwa die Partyfeierer, aber auch Kinder und Jugendliche und junge Paare, die evtl. ihren Kinderwunsch angesichts der Krise infrage stellen.
Mit den Filterblasen in den Sozialen Medien werden wir lernen müssen, zu leben und mit ihnen umzugehen. Ganz generell wird der seriöse Journalismus durch die Sozialen Medien bedroht, da stehen wir erst ganz am Anfang. Und schon ist Wissenschaftsjournalismus – zu meiner Zeit ein Traumberuf – heute fast ein Prekariat. Den herkömmlichen Medien laufen die Leser/Hörer/Zuschauer davon. Und damit zerfällt für ernsthafte Journalisten die wirtschaftliche Basis. Es wird höchste Zeit, neue Geschäftsmodelle für unabhängigen, kritischen, einordnenden Journalismus zu entwickeln. Das gilt ganz besonders auch für den Wissenschaftsjournalismus.
Sie haben als „Wissenschaftsjournalist, Wissenschaftskommunikator, Risikogruppe, Bürger“ im April einen offenen Brief an Prof. Christian Drosten geschrieben. Wie schätzen Sie heute den Einsatz von Akteuren wie ihm ein – brauchen wir mehr Dialog in dieser Form für den Wissenschaftsjournalismus?
Ich kenne die Biografie von Professor Drosten nicht gut genug, ich halte ihn daher für ein Naturtalent, einen Glücksfall für die Wissenschaftskommunikation, der genau zum richtigen Zeitpunkt aufgetreten ist. Wenn man ihn hat, braucht man eigentlich gar keine auf Wissenschaft spezialisierte Journalisten mehr. Er versteht es selbst, die Systemlogiken von Wissenschaft und Gesellschaft zu überbrücken, damit kommt jeder gute Journalist zurecht.
Doch die Mehrzahl der Wissenschaftler, die wichtige Forschungen machen, sind keine Naturtalente auf diesem Niveau. Sie müssen meist überhaupt erst einmal das Bewusstsein entwickeln, dass die Gesellschaft für sie und ihre Arbeit wichtig ist, dass sie – um ihre notwendigen Privilegien zu erhalten – sich mit der rasant wandelnden Gesellschaft austauschen müssen, die auf Transparenz, Partizipation, ja Mitentscheidung drängt, die immer mehr auch durch Neidkomplexe, Egalisierung und Skandalisierung getrieben wird, dass sie angesichts der Komplexität von Kommunikation und Medien dazu starke und professionelle Sparringspartner an ihrer Seite brauchen, nämlich gute Wissenschaftskommunikatoren. Und dann braucht es Wissenschaftsjournalisten, die sich ihrer Rolle als Vermittler zur Gesellschaft bewußt sind, die Informationen der Wissenschaftler durch Recherche, Gegenrecherche, Einordnung und Verknüpfung mit anderen Informationen und Logiken zu Wissen verarbeiten und in ihren Medien publizieren.
Ein Glücksfall reicht da nicht. Da ist noch viel Bewusstseinswandel in der Wissenschaft, in den Medien und im Wissenschaftsjournalismus notwendig. Daran versuche ich, mit meinem Blog, dem „Treffpunkt Wissenschaftskommunikation München“ #WisskomMUC* und meiner Erfahrung mitzuwirken.
* Der nächste „Treffpunkt Wissenschaftskommunikation“ findet am 3. Dezember 2020, 18.00 Uhr statt. Referentin ist Dr. Jeanne Rubner, Leiterin der trimedialen Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Thema „Wissenschaftsjournalismus digital – systemrelevant, nicht nur in der Pandemie“. Gastgeber ist das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit.
Wie sehen Sie die Zukunft des Wissenschaftsjournalismus – was muss sich in Wissenschaft, PR und Journalismus ändern; wo könnten die Stellschrauben anders gestellt werden (beispielsweise in der Aus- und Fortbildung)?
Wissenschaftsjournalismus war einmal – für mich in meiner Zeit – der schönste Beruf der Welt. Ich habe dem Journalismusforscher Prof. Stephan Russ-Mohl noch vor zwölf Jahren heftig widersprochen, als er in meiner Zeitschrift Medizin&Wissenschaftsjournalist schrieb, er würde jungen Leuten davon abraten, Wissenschaftsjournalist zu werden. Heute stimme ich ihm leider zu. Andererseits wurde in der Corona-Krise von vielen erst der Wert des Wissenschaftsjournalismus erkannt, ja er wurde sogar als „systemrelevant“ geadelt.
Die Aus- und Fortbildung ist heute schon auf einem hohen Niveau, bietet aber eher langfristige Lösungen. Vielleicht könnte sie stärker die journalistische Seite betonen, die Kreativität für Themen und Darstellungsweisen. Sicher aber muss sie sehr viel stärker in Zukunft die betriebswirtschaftliche Seite des Berufslebens berücksichtigen, denn die meisten Wissenschaftsjournalisten arbeiten als Freie oder müssen sogar im Internet ihre Miete verdienen.
Um Lösungen für die Zukunft des Wissenschaftsjournalismus zu finden, gilt es vor allem, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu fördern. Gleichgültig, ob Stiftungen, Organisationen oder Institutionen, wir müssen Wege finden, wie Wissenschaftsjournalisten im Internet erfolgreich sein können.
Denn die Zukunft liegt im Internet, wenn man allein die Lese- und Sehgewohnheiten junger Leute betrachtet, die jedes Jahr älter werden und ihre Informationsusancen dabei nicht ändern. Seriösen Print-Journalismus wird in Zukunft wohl nur noch ein kleiner Kreis von Journalisten für ein elitäres Publikum betreiben, dem Radio erwächst starke Konkurrenz durch Podcasts, das Fernsehen wird mehr und mehr zur Unterhaltung, Video-Information wird zur Domäne von Youtube und ähnlichen.
Was dringend gebraucht wird, sind Erlösmöglichkeiten für Wissenschaftsjournalisten im Internet. Da aber muss jeder Journalist, Techniker und Verleger in einer Person sein, also umdenken gegenüber den klassischen Rollen.
Und übrigens: Erfolgreiche Geschäftsmodelle für seriösen Journalismus im Internet und den Sozialen Medien, die anerkannt, geschätzt und gut sichtbar sind, sind auch die beste Strategie gegen „Fake News“ und Meinungsblasen, die tatsächlich zu einer Gefahr für unsere demokratische Gesellschaft werden können.



















