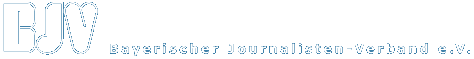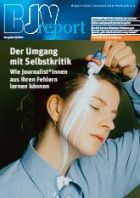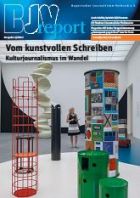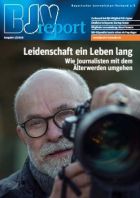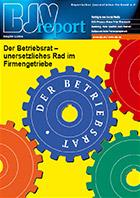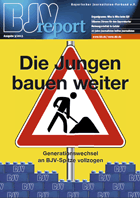Ausgabe 1 / 2019
„Schauen Sie jedes Wort kurz an“
Wird mit aggressivem Vokabular Politik gemacht, bewegen sich Journalisten auf heiklem Boden. Wiederholen sie sprachliche Entgleisungen unreflektiert, spielen sie dem Populismus in die Hände.
Es handle sich um einen Begriff, der letztlich geltendes Asylrecht verhöhne, erklärte Sprachwissenschaftlerin und Juryvorsitzende Nina Janich vor wenigen Wochen bei Bekanntgabe des Unworts des Jahres 2018. Die Rede ist von „Anti-Abschiebe-Industrie“. Wortschöpfer war im Frühsommer 2018 Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Die Regierungspartei handelte sich damit den Vorwurf ein, die AfD offenbar rechts überholen zu wollen. Doch sind Begriffe wie „Anti-Abschiebe-Industrie“, „Kopftuchmädchen“ oder „Asyltourismus“ nur Ausrutscher? Wohl kaum, nicht selten wird mit aggressivem Vokabular Politik gemacht. Sprachliche Grenzen werden ausgereizt, Tabus bewusst gebrochen.
„Wie eine Nation sich ihr Denken einredet“
Um zu erklären, warum dies so gefährlich ist, ein Blick in die Wissenschaft. Linguisten sprechen von „Framing“ und verstehen darunter einen Rahmen, in den jedes Wort eingebettet wird. Sobald ein Begriff fällt, aktiviert das menschliche Gehirn jede Menge abgespeichertes Wissen. Heißt umgekehrt: Mit jedem Wort kommuniziert man eine Fülle von Ideen. Und je häufiger der Mensch einen Begriff hört, desto eher ist das Gehirn dazu bereit, den gesetzten Rahmen - also den Frame - als wahr anzuerkennen. „Diesen Effekt machen sich Politiker zunutze“, sagt Linguistin Elisabeth Wehling. In ihrem Buch „Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet - und daraus Politik macht“ fordert sie: Es sei höchste Zeit, die Naivität gegenüber der Bedeutung von Sprache in der Politik aufzugeben. „Wir erleben derzeit eine Verrohung der Sprache, in Deutschland vor allem mit Blick auf die AfD“, sagt sie im Interview mit dem BJVreport.
Gerade Journalisten bewegen sich hier auf glattem Eis: Einerseits kommen sie kaum umhin, über sprachliche Entgleisungen in der Politik zu berichten. „Wir können nicht so tun, als wären solche Begriffe nicht in der Welt“, sagte Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau vorigen Herbst während der Münchner Medientage. Gleichzeitig trägt deren Wiederholung aber dazu bei, dass sich politische Diskurse und gesellschaftliches Denken verschieben. Dem Populismus wird in die Hände gespielt.
von Michaela Schneider
Download:
 BJVreport 1 / 2019 (pdf, 10MB)
BJVreport 1 / 2019 (pdf, 10MB)