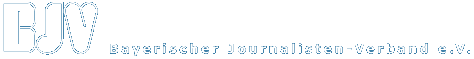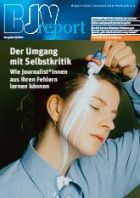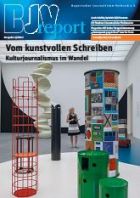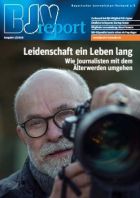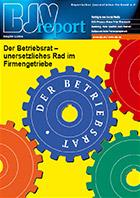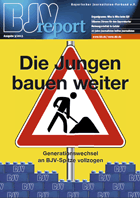Ausgabe 2 / 2018
Fließende Grenzen
Pressearbeit in digitalen Zeiten
Es ist von alters her eine Hassliebe: Journalisten und Pressesprecher können nicht mit-, aber auch nicht ohne einander. Doch dann, mit der Digitalisierung, schien sich das symbiotische Verhältnis zu verschieben. Manche Presseabteilung baute auf die ganz neuen Möglichkeiten eines direkten Dialogs mit der Öffentlichkeit. Und vor allem darauf, dass es dadurch eine Zusammenarbeit mit den kritischen, oft lästigen Journalisten nicht mehr allzu lange brauche. Neues Handwerkszeug wie Social Media, Content Marketing, die Kooperation mit Bloggern und Influencern hielt Einzug in Presseabteilungen.
Vertrauen in klassische Medien
Die - für Journalisten - gute Nachricht vorweg: Mittlerweile vergeht kaum ein Tag ohne neue Zahlen, die das Vertrauen in die klassischen Medien beschreiben. In einer Studie des Instituts Ifak für die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz gaben Ende 2017 40 Prozent der Befragten an, den Medien eher oder sogar voll und ganz zu vertrauen. 2008 waren es nur 29 Prozent. Und so setzen nicht wenige Unternehmen und Organisationen, die Botschaften effektiv platzieren wollen, weiter auch auf klassische Medien, obwohl heute jede Menge andere Kommunikationskanäle zur Verfügung stehen. Das beobachtet zum Beispiel Kommunikationswissenschaftlerin Romy Fröhlich, Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Ihr Schwerpunkt: Public Relations. Mit Zielgruppen zu plaudern und marketingähnliche Kundenkommunikation seien etwas anderes, als mit den Rezipienten über klassische Medien zu kommunizieren. „Letzteres hat eine ganz andere Glaubwürdigkeit“, sagt die Wissenschaftlerin.
„Grundsätzlich hat sich an den Zielsetzungen der klassischen PR, Orientierung zu bieten, Glaubwürdigkeit zu stärken und Vertrauen zwischen einem Unternehmen und seinen Teilöffentlichkeiten aufzubauen, nicht viel geändert“, sagt auch Sascha Ihns, Mitglied im Vorstand der BJV-Fachgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Er arbeitet als selbstständiger Kommunikationsmanager und unterrichtet als Dozent für PR und Social Media in Ismaning und Köln. Allerdings seien die Aufgabenbereiche der PR durch die Digitalisierung komplexer, technisch vielschichtiger und ihre Umsetzungen schneller geworden.
Andere Dinge hätten sich heute dank verschiedener Software-Werkzeuge vereinfacht, etwa um in Echtzeit ein Abbild davon zu erhalten, wie Menschen über ein Unternehmen, seine Produkte oder Dienstleistungen sprechen. Man höre in den Markt hinein, nehme Anregungen von außen auf, gehe auf Kritik ein. Gleichzeitig seien PR-Manager laut Ihns Geschichtenentwickler innerhalb eines Unternehmens, die darüber hinaus die Strategien der Führungskräfte übersetzen: Zum einen nach innen für die Mitarbeiter durch Medien wie Intranet, Mitarbeiter-Apps, die klassische Werkszeitung oder direkte Gespräche. Zum anderen nach außen über klassische und Online-Medien, den unternehmenseigenen Newsroom oder ebenfalls im direkten Dialog.
Bei der Kommunikation nach außen hat aus Ihns’ Sicht die Pressemitteilung nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. Allerdings sollten Presseabteilungen keinesfalls die gleiche Pressemeldung an sämtliche Redaktionen schicken, sondern darauf achten, dass diese für verschiedene Redaktionen zielgerichtet aufgearbeitet ist. Die Tendenz steigt, dass bei unterbesetzten Redaktionen Journalisten Pressemitteilungen nahezu 1:1 in Publikationen übernehmen. Eine Chance für Presseabteilungen? Ihns zweifelt daran. „Ein Journalist sollte nach wie vor kritisch hinterfragen“, sagt er. Eine Nachricht in einem als unabhängig wahrgenommenen Medium erhöht den Wert einer Botschaft in den Augen des Publikums - und damit auch fürs Unternehmen.
von Michaela Schneider
Download:
 BJVreport 2 2018 (pdf, 5MB)
BJVreport 2 2018 (pdf, 5MB)